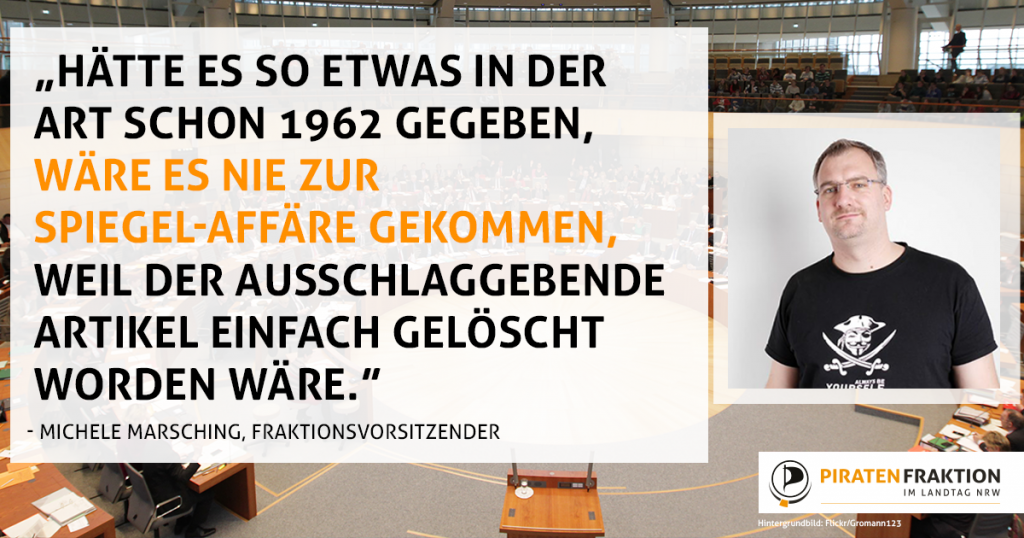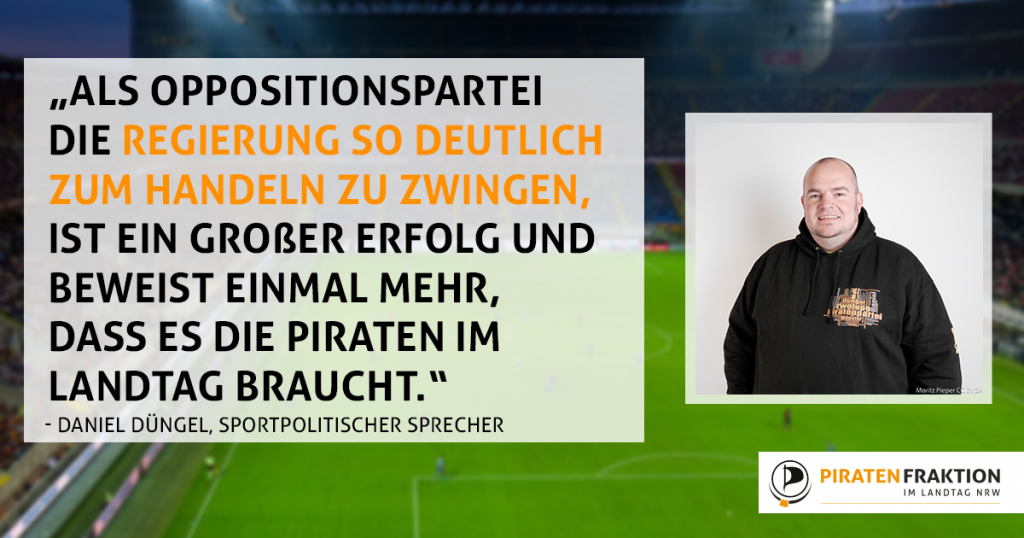I. Darstellung
Sobald die Folgekosten des Braunkohletagebaus geklärt sind und das Braunkohleausstiegsgesetz verabschiedet wurde, ist der Weg frei, die Chance zu nutzen, im Bereich der Tagebaue wie Garzweiler NRW neu zu denken.
Es steht eine verkehrlich teilweise bereits angebundene, ansonsten auch mit dem Schienenpersonennahverkehr gut zu erschließende riesige Fläche zur Verfügung, die keine Flächenkonkurrenzen aufweist und gesellschaftlich sowie wirtschaftlich genutzt werden kann.
Die entsprechende Ansiedlung von Gewerbe oder Industrie funktioniert nicht ohne die dazu erforderliche Wohnbebauung, da Zersiedlung, lange Pendlerwege und eine unzureichende Durchmischung vermieden werden müssen. Die Idee eines großen internationalen Flughafens als Ersatz für alle anderen NRW-Flughäfen muss jedoch auf Grund der Ungewissheit bezüglich der Akzeptanz und der hohen Kosten verworfen werden.
Als Pioniervorhaben eignet sich jedoch eine touristische Nutzung in Form eines modularen und sukzessive auszubauenden Ferienparks, der anschließend mit Wohnbebauung, Gewerbe, Handel und Industrie verbunden werden kann. Von diesem Kern aus kann die modernste Stadt Europas wachsen.
Von Beginn an sollte die Dimension der Stadt in 5, 10, 20, 30 und 40 Jahren skizziert werden. Eine gewisse Größe ist erforderlich, um zunächst alle Einrichtungen eines Oberzentrums und dann auch überregionale Einrichtungen in der Stadt anbieten zu können. So sollte davon ausgegangen werden, dass hier binnen 40 Jahre eine Großstadt mit mindestens 100.000 Einwohnern entsteht.
NRW wächst. Wir werden in NRW bis 2057 einen insgesamt starken Bevölkerungszuwachs auch durch Zuwanderung haben und können nicht davon ausgehen, dass die schrumpfenden Regionen in NRW hiervon profitieren. Dort ist es ehrlicher, mit einem schrumpfenden Prozess umzugehen. Dennoch müssen die boomenden Städte entlastet werden. In anderen Teilen der Welt und zu anderen Zeiten ist in solchen Fällen die Neugründung einer Stadt obligatorisch.
Die neue Stadt soll Vorbild und Experimentierfeld für neue Technologien und auch eine neue Gesellschaft sein. Aktive, tatkräftige Menschen voller Ideen und Veränderungswillen – Pioniere – werden in die neue Stadt ziehen. Dieses Potential gilt es zu nutzen.
Die älteren Städte Nordrhein-Westfalens werden durch die Musterfunktion, das Ausprobieren neuer Wege als auch durch den Wettbewerb und einen Imagegewinn stark von der neuen Stadt profitieren.
Die moderne Verkehrswende wird in der neuen Stadt bereits Realität sein. Die Mobilität innerhalb der Stadt wird ohne eigenes Auto möglich sein. Die Stadt verfügt statt riesiger Auto-Verkehrsflächen über Freiräume und kinderfreundliche Wege. Sie ist vollvernetzt und bietet neben der ubiquitären Verfügbarkeit von Breitbandinternet zahlreiche via OpenData-Schnittstellen zur Verfügung gestellte Stadt-Informationen von der Luftqualität bis zur Mobilität. Wirtschaft und Gesellschaft haben hier die Möglichkeit, sich neu auszuprobieren, weil für viele Regeln und Gesetze, die bisher den Austausch freien Wissens oder das Etablieren neuer Geschäftsmodelle verhindern, spezielle Ausnahmen gelten. Die neue Großstadt wird ein Experimentierfeld und eine Sonderwirtschaftszone sein. Sie wir der Nährboden für ein ganz neues NRW.
II. Beschluss
Der Mitglieder des Landtags werden mit hoher Priorität darauf hinarbeiten, dass die experimentierfreudige Großstadt Wirklichkeit wird. Dazu gehören die Klärung aller Fragen zur Braunkohle (Folgekosten, Ausstiegsgesetz), die gesetzliche Ermöglichung für eine Sonderwirtschaftszone und die finanzielle und personelle Ausstattung, die die hohe Priorisierung unterstreicht.