Fraktionssitzung vom 23.02.2016
70 Jahre Landeszentrale für politische Bildung: Wir brauchen jetzt mehr politische Bildung für alle
I. Sachverhalt
Vor 70 Jahren wurde in NRW die „Staatsbürgerliche Bildungsstelle“ gegründet, die am 1. Oktober 1967 in „Landeszentrale für politische Bildung“ umbenannt wurde. Die Aufgaben der „Landeszentrale für politische Bildung“ sind vielfältig: Sie soll die demokratisch-politische Kultur, Demokratiekompetenz, den kritischen Umgang mit Medien und die Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte fördern sowie die Teilhabe an politischen Prozessen und das politische und bürgerschaftliche Engagement steigern. Je nach aktueller Herausforderung setzt sie jährliche Schwerpunkte.
Seit vielen Jahren zeichnet sich in NRW ab, dass Menschen- und Demokratiefeindlichkeit in erschreckendem Ausmaß zunehmen. In den letzten Monaten ist besonders die Gruppe der Flüchtlinge ins Visier der Rechtspopulisten und Rechten gera-ten. Am Dienstag, den 26.01.2016 veröffentlichte das nordrhein-westfälische Innen-ministerium die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Straftaten gegen Flüchtlinge und deren Unterkünfte. Seit 2014 hat sich die Zahl der flüchtlingsfeindlichen Straftaten von 25 auf 214 im Jahr 2015 verachtfacht.
Lange Zeit wurde diese Entwicklung in NRW und Deutschland verharmlost: Die Aufklärungsquote bei menschenfeindlichen Straftaten ist sehr niedrig und die Dunkelziffer ist viel zu hoch. Seit Jahren wird bemängelt, dass Hasskriminalität oft von Polizei, Politik und Justiz unterschätzt wird. Das hat nicht zuletzt die Aufdeckung der Gewalttaten des NSU verdeutlicht. Seit Jahren warnen Experten vor der zunehmenden Radikalisierung von sogenannten Rechtspopulisten, deren Positionen durch demokratische Parteien zum Teil aufgegriffen werden.
Dieses Wochenende wurde leider wieder ein Höhepunkt menschenfeindlicher Ausschreitungen erreicht: Im sächsischen Clausnitz setzte eine rassistische Menge einen Bus mit Familien über Stunden fest, die zu einer Flüchtlingsunterkunft gefahren wurden. Die Gruppe hatte mit drei Autos die Straße zum Flüchtlingsheim versperrt. Die Frauen und Kinder im Bus äußerten in Interviews, dass sie Angst um ihr Leben gehabt hätten. Kurz danach brannte wieder eine Flüchtlingsunterkunft – diesmal in Bautzen und unter Beifall von Schaulustigen.
Im Landtag wurde nach Silvester eine verstärkte demokratische und politische Bildung von Flüchtlingen gefordert. Es sollte aber mittlerweile allen klar sein, wie wichtig es ist, dass parallel zu solchen Forderungen immer Position gegen die Zunahme der demokratie- und menschenfeindlichen Einstellungen bezogen werden muss. Es braucht eine politische Bildungsoffensive, und zwar für alle. Politische Bildung ist der Schlüssel zur Vermeidung von Rassismus und religiöser Radikalisierung sowie zur Förderung des Pluralismus und der Demokratie. Es ist fatal, wenn im Landtag der Eindruck vermittelt wird, dass nur Neuankömmlinge Nachhilfe im Bereich Grundrechte und staatsbürgerliche Pflichten brauchen würden. Auch haben nicht nur Neuankömmlinge Nachholbedarf, wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen und Männern geht. Das wird leider zurzeit wieder einmal offensichtlich: In Köln stehen Vorwürfe im Raum, dass Wachleute geflüchtete Frauen auf sexueller Grundlage beleidigt hätten. Die hiesige Gesellschaft hat mit Sexismus und sexualisierter Gewalt seit Jahrzehnten zu kämpfen. So wurde erst am 15. Mai 1997 die Gleichstellung des Strafbestands der Vergewaltigung innerhalb und außerhalb der Ehe im Bundestag beschlossen. Bis dato konnte sexualisierte Gewalt innerhalb der Ehe allenfalls als „schwere Nötigung” angezeigt werden.
In der letzten Woche kündigte das Niedersachsen an, das Angebot der politischen Bildung auszuweiten. Es ist auch in NRW höchste Zeit, gegen Vorurteile Position zu beziehen und Werte wie Solidarität, Toleranz und Hilfsbereitschaft hochzuhalten.
II. Der Landtag stellt fest:
- Wir verurteilen menschenfeindliche Anschläge, Ausschreitungen, Hetze und deren ideologische Unterstützung durch Parteien, bestimmten Medien und Institutionen auf das Schärfste.
- Der Landtag setzt ein Zeichen für Demokratie und gegen Menschenfeindlichkeit und bedankt sich bei allen Initiativen und Institutionen, die sich seit Jahrzehnten gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Sexismus, Nationalismus und für Vielfalt, Humanität und Demokratie einsetzen.
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
- den Etat für die „Landeszentrale für politische Bildung“ zu verdoppeln.
- zivilgesellschaftliche Organisationen in die Analyse, Dokumentation und Entwicklung von Abwehrmaßnahmen gegen Menschenfeindlichkeit viel stärker als bisher einzubeziehen und ihre wertvolle Arbeit auf eine Langzeitfinanzierung umzustellen.
Heißt es Digitale Wende, Wandel oder Revolution?
Einführung einer Steuer auf Waffenexporte in Höhe von 19 %
Waffenexporte müssen besteuert werden!
Menschen flüchten vielfach vor Krieg oder kriegerischen Auseinandersetzungen, die auch mit deutschen Waffen geführt werden. Daher müssen die Mitverursacher, in diesem Fall die Waffenexporteure, mit in die Verantwortung genommen werden, die Folgen dieser Auseinandersetzungen abzumildern.
Daher haben Britta Söntgerath und ihr Team (und ein bisschen ich) folgendes Positionspapier für den nächsten Bundesparteitag der Piraten in Deutschland und den nächsten Landesparteitag der Piraten in NRW erarbeitet:
Die Zahlen sind alarmierend. Nach Schätzungen der UNO-Flüchtlingshilfe sind weltweit 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Syrien, Jemen, Südsudan sind zum traurigen Sinnbild für Bürgerkrieg, Terrorismus und Vertreibung geworden. Zur Wahrheit gehört es, auch den deutschen Anteil an diesen Konflikten zu benennen. Durch die deutsche Waffenexportpolitik kommen beispielsweise, wenn auch unbeabsichtigt, Gewehre vom Modell G36 im Jemen zum Einsatz.
Aus diesem Grund fordern wir, dass Deutschland und die Waffenproduzenten für ihr Handeln endlich Verantwortung übernehmen. Konkret fordern wir die Einführung einer Steuer auf Waffenexporte in Höhe von 19 %. Durch die Mehreinnahmen sollen zwei Dinge finanziert werden: Erstens muss mehr Geld in die Hand genommen werden, um die Fluchtursachen zu bekämpfen und die humanitäre Hilfe für die betroffenen Menschen in den Bürgerkriegsländern erheblich aufzustocken. Zweitens soll das Geld für Geflüchtete und ihre Integration in Deutschland eingesetzt werden. Diese fängt bei mehr Mitarbeitern im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an, geht über die finanzielle Entlastung der Kommunen und hört bei der Arbeit mit Geflüchteten vor Ort auf. Besonders wichtig sind uns dabei Sprachkurse und eine ausreichende medizinisch-psychologische Versorgung – Grundlagen für eine schnelle Integration in Deutschland und auf dem Arbeitsmarkt.
Eine Steuer auf Waffenexporte öffnet also Handlungsspielräume, wo vorher nur Stillstand und gute Absichtserklärungen standen. Leider ist derzeit nicht absehbar, dass die weltweiten Konflikte abnehmen werden. Deutschland steht in der Verantwortung. Die Steuer auf Waffenexporte ist ein kleiner Beitrag, das weltweite Leid zu mindern.
Auf den kommenden Seiten wird die Begründung für die Einführung einer Steuer auf Waffenexporte breiter aufgefächert und statistisch unterfüttert.
Antragssteller:
Britta Söntgerath (Kapetanio) und Torsten Sommer (ToSo)
Autor:
Christian Sprenger
Positionspapier
1. Einleitung
Es sind Sätze wie „über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte entscheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situation nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspolitischer Erwägungen“ (Bundestag Drucksache 18/5978), die sich nur schwer in Einklang mit der gängigen Waffenexportpraxis der Bundesregierung bringen lassen.
Nach Informationen des Spiegel hält Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) an einem umstrittenen Waffendeal mit Saudi-Arabien fest und wird die Lieferung von 15 Patrouillenbooten genehmigen. Zur Erinnerung: Erst kürzlich stand Saudi-Arabien weltweit in der Kritik für die Hinrichtung von 47 Menschen.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen ersten Überblick über die Waffenexporte, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Empfängerländern (Drittländern):

Abbildung 1 Waffenexporte in Drittländer 1. Halbjahr 2015
Wie ein Blick auf die Tabelle nahelegt, können sich diverse Länder, auch wenn sie weit davon entfernt sind, als demokratisch zu gelten, über Waffenlieferungen freuen. Saudi-Arabien befindet sich beispielweise in einem Konflikt mit der Republik Jemen. Fernab politischer Deutungen, führt dieser Konflikt dazu, dass 21 Millionen Menschen im Jemen auf humanitäre Unterstützung angewiesen sind. Auch wenn dieses Beispiel nur ein Mosaikstein des weltweiten Konfliktgeschehens und Migrationsbewegungen der Geflüchteten darstellt, hat es explizite Auswirkungen auf die aktuelle deutsche Situation und entlarvt den eingangs zitierten Satz als Nebelkerze.
2. Nexus zwischen Geflüchteten und deutschen Waffenexporten
Während die Kakofonie um Obergrenzen, Grenzzäune und Familiennachzug in der Debatte um Geflüchtete immer lauter wird, setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass die Zahlen der Geflüchteten nur reduziert werden können, wenn man an den Fluchtursachen ansetzt. Aus Sicht der Piratenpartei ein längst überfälliger Schritt. Auch wenn die individuellen Gründe für eine Flucht verschieden sein mögen, sind die Ursachen für Flucht in der Regel bewaffnete Konflikte, politische und religiöse Verfolgung, fragile Staatlichkeit und Klimakonflikte. Diese Tatsache spiegelt sich auch in den Herkunftsländern der Geflüchteten im Jahr 2015 wieder:

Abbildung 2 Woher kommen Geflüchtete im Jahr 2015
Mit Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea und Pakistan kommt der überwiegende Anteil (54%) von Geflüchteten aus Ländern, in denen Bürgerkrieg herrscht oder der Daesch und andere Terrororganisationen ein friedliches Leben unmöglich machen.
3. Waffenexportsteuer als Instrument der Fluchtursachenbekämpfung
Nur wie kann man den einzelnen Ländern helfen und vor allem den vielen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind? Mit einem Gesamtetat von 7,407 Milliarden Euro des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für das Jahr 2016 wird man nur schwerlich die Fluchtursachen eindämmen können. Für die Piratenpartei ist es daher unerlässlich, das Entwicklungshilfebudget aufzustocken und zusätzliche Mittel bereitzustellen.
Diese Mittel sollen aus einer Steuer auf Waffenexporte generiert werden.
Steuern haben grundsätzlich die Aufgabe, den Finanzbedarf für ein politisches Handeln sicherzustellen. Fluchtursachen stehen mittlerweile prominent auf der politischen Agenda, es fehlt jedoch noch der monetäre Wille, der für einen effektiven Einsatz notwendig ist. Die Handlungsfähigkeit würde also durch zusätzliche Einnahmen aus der Waffenexportsteuer sichergestellt. Wie viel Geld zusätzlich eingenommen werden kann, wird nachfolgend exemplarisch dargelegt.
Deutschland zählt zum viertgrößten Waffenexporteur weltweit. Im ersten Halbjahr 2015 erteilte Bundesregierung Einzelgenehmigungen in Höhe von 3.455.442.275 Euro.

Abbildung 3 Waffenexporte 1. Halbjahr 2015
Deutsche Unternehmen haben also in erheblichem Ausmaß von Waffenexporten in teilweise instabile Länder profitiert. Auch wenn es sicherlich nicht gewollt ist, kommen deutsche Kleinwaffen durch Weiterverkäufe auch in Bürgerkriegsländern zum Einsatz und sind daher indirekt mitverantwortlich für Fluchtbewegungen. Zwar reagierte die Bundesregierung durch die Verabschiedung von Kleinwaffengrundsätzen auf diesen Umstand, der Erfolg ist aber mehr als fragwürdig. Allen Beteuerungen und Aktionismus der Bundesregierung zum Trotz, gelangte das deutsche Gewehr G36 in Mexiko in die Hände eines Drogenkartells und wirft ein dubioses Licht auf die, wie es Neudeutsch heißt, Post-Shipment-Kontrollen. Mit Hinweis auf ein laufendes Strafverfahren, verweigert die Bundesregierung derzeit eine Stellungnahme (Bundestag Drucksache 18/6778).
Ähnlich verhält es sich bei der Lizenzproduktion. Hier werden die Waffen durch Vergabe von Lizenzen im jeweiligen Empfängerland hergestellt. Allerdings müssen Lizenzproduktionen nicht gesondert genehmigt werden, wodurch keine statistische Abbildung durch die Bundesregierung erfolgt (Bundestag Drucksache 18/1218). Dass eine Proliferation an Dritte auch hier nicht ausgeschlossen werden kann, liegt auf der Hand. So erteilte die Bundesregierung im Jahr 2008 die Genehmigung für die Lizenzproduktion des Gewehres G36 in Saudi-Arabien. Unlängst wurde bekannt, dass Saudi-Arabien das G36 an jemenitische Milizen geliefert hat, die es für den Kampf gegen die Huthi-Rebellen eingesetzt haben. Wie die Bundesregierung einräumen musste, geschah dies ohne ihren Kenntnisstand. Abermals stellt sich die berechtigte Frage: Wie sorgfältig kann der Endverbleib der Waffen kontrolliert werden?
Kurzum: Wer den Export von Waffen oder Lizenzen genehmigt, muss auch die Konsequenzen dafür tragen und politische Verantwortung übernehmen. Damit Deutschland und insbesondere die Kriegswaffenproduzenten ihrer Verantwortung gerecht werden können, die aus den Waffenexporten resultiert, schlägt die Piratenpartei eine Waffenexportsteuer äquivalent zur Umsatzsteuerbefreiung für exportierende Unternehmen in Höhe von 19 % vor.
So könnten, nur bezogen auf die Halbjahreszahlen der Einzelausfuhrgenehmigungen 2015, zusätzlich 656.534.032 Euro generiert werden. Auch wenn hiervon noch Verwaltungskosten abzuziehen sind, entstehen so erhebliche Mehreinnahmen, die zweckgebunden für die Arbeit mit Geflüchteten und Fluchtursachenbekämpfung eingesetzt werden sollen. Mit einem drastischen Einbruch der Exportzahlen durch die Waffenexportsteuer kann nicht gerechnet werden. Deutsche Waffen genießen ein gutes Renommee und werden daher auch zukünftig in einem vergleichbaren Maße nachgefragt werden.
Politische Verantwortung erschöpft sich nicht durch Scheindebatten über einen Plan A2 und Plan B innerhalb der Flüchtlingspolitik. Politische Verantwortung fängt dort an, wo Zusammenhänge ehrlich offengelegt und benannt werden. Aus Sicht der Piratenpartei stellt die Waffenexportsteuer einen ersten Schritt dar, den vielen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, zu helfen. Wer, wie Bundespräsident Gauck im vergangenen Jahr, mehr außenpolitische Verantwortung fordert, muss auch dementsprechend handeln, auch wenn es den Waffenexporteuren nicht gefallen dürfte.
4. Die Deutsche Waffenexportpolitik auf einen Blick
Die nachfolgenden Abbildungen geben einen Überblick der deutschen Waffenexportpolitik. Allein an diesen Schaubildern wird deutlich, dass Deutschland und die deutschen Unternehmen in erheblichem Ausmaß von den Waffenlieferungen profitieren.

Abbildung 4 Ausfuhrgenehmigungen an Drittländer in Millionen Euro; 2004 – 2014

Abbildung 5 Kleinwaffen- und Munitionsgenehmigungen an Drittländer

Abbildung 6 Kriegswaffenausfuhren 2004 – 2014
Das Positionspapier als PDF zum Download.
Die IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen muss sicher bleiben – die Gesundheit der Patientinnen und Patienten darf nicht zum Spielball von Kriminellen im Netz werden!
I. Sachverhalt
In den letzten Wochen und Monaten wurden zahlreiche Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen (u.a. in Neuss, Arnsberg, Kleve, Mönchengladbach, Essen) Opfer einer breit gestreuten Attacke durch Schadsoftware: In den meisten Fällen gelang es Kriminellen, zum Beispiel mithilfe fingierter E-Mails oder infizierter Webseiten, Schadsoftware zu installieren. Bei der Software handelte es sich um den Typus „Ransomware“. Diese besonders heimtückische Art der Schadsoftware verschlüsselt nach der Infektion unbemerkt sämtliche Datenträger des Angriffsziels, sodass nicht mehr auf die Daten zugegriffen werden kann. In den betroffenen Krankenhäusern wurden die EDV-Systeme nach den Angriffen aus Sicherheitsgründen komplett vom Netz genommen und heruntergefahren. Im Neusser Lukaskrankenhaus mussten aus diesem Grund Operationen verschoben und Herzinfarktpatienten in andere Krankenhäuser mit funktionierender IT-Infrastruktur verlegt werden.
Die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen stehen derzeit vor einer großen Herausforderung: Viele medizinische Geräte laufen noch unter veralteten Betriebssystemen, die von den Herstellern nicht mehr gewartet oder mit Updates versorgt werden. So endete der Support für die 2001 auf den Markt gekommene „embedded“-Version von Windows XP am 12. Januar 2016. Die Arbeit mit 15 Jahre alter Software macht Krankenhäuser zu einem leichten Ziel für Kriminelle und ist die eigentliche Ursache für eine landesweite – aller Wahrscheinlichkeit nach bundesweite – Sicherheitskatastrophe im Gesundheitswesen, die mit vorausschauender Politik und Investitionen in die sogenannte „Kritische Infrastruktur“ hätte verhindert werden können.
Dabei ist es gerade im Gesundheitswesen dringend geboten, die Vulnerabilität der IT-Systeme und die damit einhergehenden Risiken weitestgehend zu minimieren und die Resilienz der Systeme zu stärken. Denn insbesondere im Gesundheitswesen handelt es sich zumeist um überlebensnotwendige Infrastrukturen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung es zu erheblichen Störungen oder anderen dramatischen Folgen kommen kann. Kettenreaktionen, bei denen der Ausfall einer Kritischen Infrastruktur zum Ausfall einer anderen Infrastruktur führen würde, Versorgungsengpässe und gar Todesfälle sind absehbar.
Bereits im Februar 2011 hat das damalige Bundeskabinett eine Cyber-Sicherheitsstrategie zum Schutz von Kritischer Infrastruktur beschlossen. Am 15. Juli 2015 trat das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) in Kraft. Betreiber Kritischer Infrastrukturen werden darin verpflichtet, ein Mindestniveau an IT-Sicherheit einzuhalten und dem Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) Sicherheitsvorfälle zu melden.
Bis heute ist allerdings unklar, welche der 365 Krankenhäuser in NRW davon betroffen sein werden und was einen „meldepflichtigen Sicherheitsvorfall“ darstellt. Möglicherweise werden 35 bis 50 Krankenhäuser der Schwerpunkt- und Maximalversorgung in NRW von dem IT-Sicherheitsgesetz adressiert.
Die aktuellen Computerangriffe auf zufällig ausgewählte Krankenhäuser verdeutlichen, dass über die vom IT-Sicherheitsgesetz angesprochenen Krankenhäuser hinaus, alle Krankenhäuser auf den neuesten Stand der Technik aufgerüstet werden müssen.
So wird mit dem Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendung im Gesundheitswesen (E-Health-Gesetz) ein konkreter Fahrplan für die Digitalisierung der Krankenhäuser, insbesondere die Einführung von digitalen Stammdaten und elektronischen Patientenakten sowie die bundesweite Einführung einer Telematik-Infrastruktur, festgeschrieben. Dabei sollen sämtliche Arztpraxen und Krankenhäuser bis 2018 flächendeckend an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen werden (flächendeckender Roll-out).
Es zeigt sich, dass die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, die mit dem IT-Sicherheitsgesetz und dem E-Health-Gesetz einhergehen, erhebliche Anforderungen an den neuesten Stand der Technik in allen Krankenhäusern in NRW stellen. Jedoch mangelt es an einer flächendeckenden auskömmlichen Bereitstellung von Investitionsmitteln, um die gesetzlichen Anforderungen erfüllen zu können.
Die Landesregierung, die nach §18 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW (KHGG NRW) neben der Förderung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten auch für die Förderung der Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als drei Jahren bis zu 15 Jahren (EDV-Systeme) zuständig ist, stellt für das Haushaltsjahr 2016 rund 500 Millionen Euro für sämtliche Investitionsbedarfe zur Verfügung.
Die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen investieren nach Angaben der Krankenhausgesellschaft 1,5 Prozent ihres Budgets in die IT-Infrastruktur. Im Vergleich dazu liegt die Investitionsquote bei den Sparkassen bei zehn bis 15 Prozent.
Bei 365 Krankenhäusern in NRW mit einem Gesamtbudget von 16 Milliarden Euro wird so von den Kliniken im Durchschnitt nur rund 700.000 Euro jährlich (inklusive Personalkosten) in den IT-Bereich investiert. Der in Fachkreisen geschätzte Bedarf liegt im Durchschnitt pro Krankenhaus allerdings bei circa drei Millionen Euro jährlich. Während der Gesamtbedarf an IT-Investitionsmitteln damit bei rund einer Milliarde Euro liegt, stagniert der Landesförderbetrag seit Jahrzehnten.
Im Jahr 1992 lag die Investitionskostenfinanzierung der Bundesländer noch bei 3,8 Milliarden Euro. Zwanzig Jahre später im Jahr 2012 haben die Bundesländer nur noch 2,6 Milliarden Euro im Bereich Investitionskostenförderung für Krankenhäuser zur Verfügung gestellt. Die Fördersumme der Bundesländer reduzierte sich somit um rund 30 Prozent. Der Anteil der Bundesländer an den Krankenhauskosten ist insgesamt von zehn auf drei Prozent gefallen. Als direkte Folge dieser mangelnden Investitionskostenförderung der Landesregierungen ist eine veraltete IT-Infrastruktur festzustellen.
Computerangriffe auf Kritische Infrastrukturen können nicht alleine durch die Verabschiedung von Gesetzen oder die schlichte Installation von Virenscannern verhindert werden. Vielmehr müssen die Systeme auf dem aktuellsten Stand der Technik sein und die Personen, die diese Systeme bedienen, müssen digitale Infektionsgefahren erkennen und vermeiden können. Bei der Gewinnung von IT-Fachkräften konkurrieren Krankenhäuser jedoch häufig mit Arbeitgebern aus der IT-Branche, die überdurchschnittliche Gehälter bezahlen.
Die Schwierigkeit, IT-Abteilungen in Krankenhäuser kompetent zu besetzen, kann auch dazu führen, dass EDV-Systeme entsprechend schlecht gewartet werden, Datensicherungen nicht immer aktuell sind und das medizinische Personal nicht richtig über die Gefahren und Vermeidung von Infektionen der IT-Systeme aufgeklärt und geschult werden.
II. Der Landtag stellt fest
- Die IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen ist marode und veraltet.
- Die marode und veraltete Infrastruktur der Krankenhäuser bietet Kriminellen aus aller Welt eine große Angriffsfläche und gefährdet das Leben der Patientinnen und Patienten.
- Die Landesregierung ist für die Investitionskostenförderung und damit unmittelbar für die IT-Infrastruktur der Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen zuständig.
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf
- Die Investitionskostenförderung für Krankenhäuser um 500 Millionen Euro auf eine Milliarde Euro anzuheben.
- Ein Konzept für die Einführung von verpflichtenden und regelmäßigen IT-Sicherheitsaudits für Krankenhausbetreiber zu entwickeln.
- Sich für die Gewinnung von kompetenten IT-Fachkräften in Krankenhäusern einzusetzen.
- In Zusammenarbeit mit der Krankenhausgesellschaft die bestehenden Angebote von IT-Schulungen für Mitarbeiter weiter zu entwickeln und auszuweiten.
Mitschnitt der kompletten Debatte zum Antrag:
Protokoll der Rede von Daniel Düngel:
Daniel Düngel (PIRATEN): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir reden über IT-Sicherheit in Krankenhäusern. Ich will kurz auf das eingehen, was in den vergangenen Wochen passiert ist. In Nordrhein-Westfalen sind rund 30 Krankenhäuser Ziel von Kriminellen geworden. Es wurden EDV-Systeme der Krankenhäuser mit Computerviren infiziert. Die Folge dieser Infektionen war: Die Krankenhäuser konnten nicht auf Daten zugreifen. Nur gegen ein Lösegeld – also Erpressung – sollten die Daten wieder freigegeben werden.
Einige Krankenhäuser haben sich daraufhin von der Versorgung abmelden müssen.
(Widerspruch von Ministerin Barbara Steffens)
Patienten mussten verlegt werden.
(Widerspruch von Ministerin Barbara Steffens)
Geplante Operationen mussten verschoben werden. Nun können wir feststellen: Wir haben letzte Woche im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales über dieses Thema bereits gesprochen. Die Ministerin hat dazu einen Bericht vorgelegt und hat versucht, das Thema etwas herunterzuspielen.
(Ministerin Barbara Steffens: Nein, das ist doch Quatsch!)
Es ist zum Glück in diesem Fall nichts Schlimmes passiert. Das können wir erst einmal festhalten.
Was finden wir in den Krankenhäusern vor? Wir haben veraltete Computersysteme. Die Krankenhäuser nutzen Windows XP, zumindest in besagtem Fall. Das ist Software, die mittlerweile selbst vom Hersteller nicht mehr unterstützt und supportet wird. Wenn ich in die Runde frage, wer von Ihnen noch ein derart altes Betriebssystem auf seinem Rechner hat – sei es dienstlich oder privat –, werden wahrscheinlich nicht allzu viele Hände nach oben gehen.
(Zuruf von der CDU: Ich!)
Wir alle versuchen, die Software möglichst aktuell zu halten, damit Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden können – übrigens auch das Gesundheitsministerium. Danach hatte ich letzte Woche auch gefragt. Im Gesundheitsministerium gibt es selbstverständlich keine Soft- und Hardware mehr, die mit Windows XP betrieben wird.
(Zustimmung von Ministerin Barbara Steffens)
Das ist schon einmal ganz gut. Allerdings: Im Gesundheitsministerium reden wir eben nicht von kritischer Infrastruktur. In den Krankenhäusern ist es offenbar dem Gesundheitsministerium wurscht, welche Software dort benutzt wird.
(Ministerin Barbara Steffens: Quatsch!)
Übrigens – den Schwenk darf ich mir an der Stelle erlauben –: Wir reden hier über Windows XP, also über ein Betriebssystem, das natürlich längst nicht mehr unterstützt wird und damit längst unsicher ist. Aber eigentlich können wir festhalten, dass alle Windows-Betriebssysteme als nicht sicher gelten und wir uns eigentlich an der Stelle über offene Standards wie Linux unterhalten sollten.
(Beifall von den PIRATEN)
Was kann passieren? Krankenhäuser können gezielt angegriffen werden. Die Versorgung in einem ganzen Regierungsbezirk kann gefährdet werden. Die Daten werden nicht nur in Geiselhaft genommen, sondern werden möglicherweise veröffentlicht. Das sind mögliche Szenarien, die dann passieren können.
Die Frage ist: Wer ist dafür verantwortlich? Unseres Erachtens muss die Landesregierung genug finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, damit die Krankenhäuser ihre IT-Infrastruktur auf aktuellem Stand halten können.
(Zuruf von der Regierungsbank: Die Krankenhäuser haben genug Geld!)
Die Ministerin sagte im Ausschuss, dafür sei sie letztlich nicht zuständig.
(Norwich Rüße [GRÜNE]: So ist das!)
Das ist einfach. Mich erinnert das dann eher an die bildlichen drei Affen: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.
(Ministerin Barbara Steffens: Das ist eine Unverschämtheit!)
„Nichts sehen“ ist der Innenminister; der sieht nichts. Die Gesundheitsministerin will nicht auf Ratschläge hören.
(Ministerin Barbara Steffens: Das ist Quatsch!)
Und die Ministerpräsidentin – gute Besserung an der Stelle – sagt überhaupt nichts zu diesen Vorfällen.
(Zuruf von den GRÜNEN: Die Ministerin stellt auch nicht die Ärzte direkt an!)
Wie hätte das verhindert werden können? Was muss in Zukunft passieren? Unser Antrag liefert dazu Lösungsansätze. Wir brauchen eben finanzielle Unterstützung für die Krankenhäuser, dass dort die IT-Infrastruktur aufgebessert werden kann. Das sehen Sie.
Wir müssen die Mitarbeiter sensibilisieren für dieses Thema. Schulungen und Sicherheitsaudits sind erforderlich. All das greift unser Antrag auf. Wir werden, da wir hier Wissensdefizite festgestellt haben – das hat sich im Ausschuss ganz klar gezeigt –, selbstverständlich zu diesem Antrag eine Anhörung beantragen, damit wir uns den Rat von externen Sachverständigen ins Haus holen können.
Zum Abschluss: Wie sehen die Lösungen der anderen aus? Auf Bundesebene erfährt unser Antrag durchaus Unterstützung. Karl Josef Laumann – in diesem Hause ja nicht unbekannt – hat zum Beispiel auch die Erhöhung der Investitionskosten auf Landesebene gefordert. Was macht die Gesundheitsministerin? Sie wartet ab, was der Bund unternimmt. Das, liebe Frau Ministerin Steffens, hilft uns aber, wenn wir auf das IT-Sicherheitsgesetz warten, nicht in der Fläche.
Präsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit.
Daniel Düngel (PIRATEN): Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. – Die Krankenhäuser, so sagt sie, müssten aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen und in eine sichere Infrastruktur investieren. Wie wollen Sie das machen, wenn die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen? Frau Steffens macht weiter wie bisher. Wann ist der Zeitpunkt gekommen, zu reagieren, zu handeln? Ich frage allen Ernstes, ob erst Patienten in den Krankenhäusern sterben müssen, damit das Gesundheitsministerium aufwacht. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall von den PIRATEN)
Schutzsuchende aufnehmen, nicht abwehren: NRW lehnt das Asylpaket II ab
I. Sachverhalt
Das Bundesverfassungsgericht hat 1994 eindeutig festgestellt, dass „für die Bestimmung eines Staates zum sicheren Herkunftsstaat die Sicherheit vor politischer Verfolgung landesweit und für alle Personen- und Bevölkerungsgruppen bestehen“ muss (BVerfGE 94, 115). Die Bundesregierung will dennoch Marokko, Algerien und Tunesien als „sichere“ Herkunftsländer festlegen. Die Sicherheit für bestimmte Menschen aus diesen Ländern ist nicht gegeben. In Marokko steht Homosexualität unter Strafe und aus allen drei oben genannten Ländern gibt es zahlreiche Berichte über gravierende Verstöße gegen die Pressefreiheit, die Meinung- und Versammlungsfreiheit.
Die Einrichtung von „besonderen Aufnahmeeinrichtungen“ – unter anderem für Personen aus „sicheren Herkunftsländern“ sowie Folgeantragstellern – führt dazu, dass abgelehnte Asylsuchende innerhalb von einer Woche gegen eine Abschiebung klagen und einen Eilantrag stellen müssen. Sie unterliegen dabei auch der Residenzpflicht, d.h. das Aufsuchen von Anwälten und/oder Asylverfahrensberatungsstellen ist auf dem Land häufig nicht möglich. Ein seriöser Rechtsschutz in der kurzen Zeit von einer Woche, ist zudem nahezu unmöglich.
Die geplanten Einschränkungen beim Familiennachzug würden bedeuten, dass Familien de facto auf Jahre getrennt werden. Dies ist mit dem Grundrecht auf Schutz der Familie (Art. 6 GG) und Art. 8 EMRK nicht vereinbar. Die geplanten Restriktionen sind nicht nur integrationsfeindlich, sondern sorgen dafür, dass die Angehörigen – vor allem Frauen und Kinder –, entweder akuten Gefahren im Herkunftsland ausgesetzt oder gezwungen sind, gefährliche Fluchtwege über das Mittelmeer zu wagen.
Für die Integration von Flüchtlingen ist der Spracherwerb unverzichtbar. Eine Eigenbeteiligung für die Teilnahme an Integrationskursen muss daher vermieden werden. Dass die wenigen verfügbaren Plätze in den Kurzen nur an Staatsangehörige aus Syrien, dem Irak, Iran und Eritrea an vergeben werden sollen, wenn diese eine gute Bleibeperspektive haben, ist ebenso skandalös, wie die Pläne, dass die Flüchtlinge für diese Leistung bezahlen sollen. Integrationskurse fallen ganz klar in den finanziellen Aufgabenbereich des Staates und die mit der Eigenbeteiligung verbundene Bürokratie ist absurd, insbesondere wenn man die derzeitige Auslastung in unseren Behörden betrachtet.
Die geplanten Verschärfung beim Abschiebungsschutz aus Gründen der physischen oder psychischen Gesundheit ist weder nachvollziehbar, noch akzeptabel. Die Nichtberücksichtigung einer Erkrankung, die sehr schwer, aber noch nicht lebensbedrohlich ist, kann mit dem Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit nicht vereinbart werden. Der komplette Ausschluss vom Asylverfahren – wenn einem Asylsuchenden vorgeworfen werden kann, sein Asylverfahren nicht mit zu betreiben, verstößt nicht nur gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, sondern ist auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention nicht vereinbar.
II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
dass „Asylpaket II“, das vom Bundeskabinett am 3. Februar 2016 beschlossen wurde, in jeder Hinsicht politisch abzulehnen und im Bundesrat, soweit damit befasst, dagegen zu stimmen.
Mitschnitt der Plenardebatte:
Podiumsdiskussion Bedingungsloses Grundeinkommen
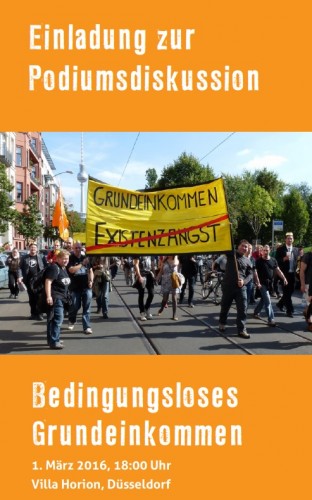 Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist in aller Munde. Wir bringen zu dem Thema interessante Gesprächspartner zusammen und laden ein zur
Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist in aller Munde. Wir bringen zu dem Thema interessante Gesprächspartner zusammen und laden ein zur
Podiumsdiskussion
Bedingungsloses Grundeinkommen
am 1. März 2016, in der Villa Horion, Johannes Rau Platz, 40213 Düsseldorf
Einlass: 17:30 / Beginn: 18 Uhr / Ende: 20:30 Uhr
Anschließend Get together im KIT, Mannesmannufer 1b (an der Kniebrücke)
Versagen auf ganzer Linie – Landesregierung hat Situation in Flüchtlingunterkünften nicht im Griff
Simone Brand, Flüchtlingspolitische Sprecherin der Piratenfraktion NRW, zu den Vorwüfen der Bewohnerinnen der Flüchtlingsunterkunft in der Westerwaldstraße in Köln gegen Sicherheitsfirma und Stadt Köln:
Der Hilferuf der Bewohnerinnen in der Kölner Flüchtlingsunterkunft zeigt, dass die Landesregierung die katastrophale Situation in den Unterkünften für geflüchtete Menschen in NRW immer noch nicht im Griff hat. Innenminister Jäger schafft es nicht, die Zustände vor Ort zu verbessern. Der offene Brief aus Köln ist ein Armutszeugnis für die Landesregierung und für die Stadt Köln. Herr Jäger versagt mal wieder auf ganzer Linie.
Flughafen Düsseldorf und die Bodenabfertigungsdienst-Verordnung
Kleine Anfrage 4469
Sommer, Torsten; Bayer, Oliver PIRATEN Drucksache 16/11156 17.02.2016 1 S.
Systematik: Luftverkehr
Schlagworte: Bodenabfertigungsdienst-Verordnung * Beschwerde * Fachaufsicht
Region: Düsseldorf, krfr. Stadt
Antwort MBWSV Drucksache 16/11471 15.03.2016 2 S.
