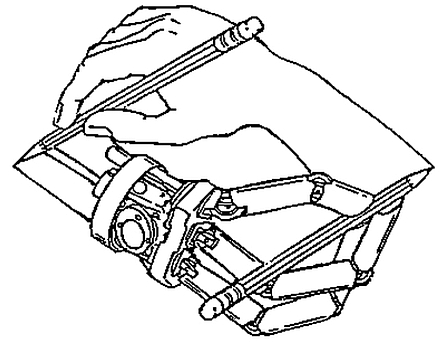
„Solange etwas ist, ist es nicht das, was es gewesen sein wird.“ Martin Walser
Aufriss
„Das Menschenbild des Silicon Valley ist das der Kybernetik, nicht das der Aufklärung“, äußerte der Philosoph Richard David Precht am 16.12.2017 in einem Interview des Magazins FOCUS anlässlich einer Buchveröffentlichung. Auf die Rückfrage des Interviewers, was das denn bedeute, erläuterte er, dass „die Aufklärung“ … „den Menschen als Individuum“ betrachte, sie seinen Wunsch des Gebrauchs der Freiheit respektiere und ihn auffordere, „die eigene Urteilskraft zu schärfen, damit er als mündiger Bürger zur Entwicklung der Gesellschaft beitragen“ könne. Allerdings, so führte Precht weiter aus, müsse „dieser Bürger natürlich auch eine Struktur in der Gesellschaft vorfinden, die es ihm“ ermögliche, „sich mit seinen individuellen Vorstellungen an ihr zu beteiligen.“
Grundlegend anders sei hingegen das Menschenbild der Kybernetik. Es gehe laut Precht davon aus, „dass sich der Mensch seiner Umwelt anpasst.“ … „Was Lust auslöst, das findet der Mensch gut, und was Unlust auslöst, findet er schlecht. Wenn ich also das Verhalten der Menschen verändern will, dann muss ich – wie bei Tierversuchen im Labor – einfach ihre Umweltbedingungen verändern, indem gezielt andere Lust- bzw. Erfolgsreize gesetzt werden, gewinne ich Einfluss auf das Verhalten der Leute, ohne Rücksicht auf Vorstellungen von individueller Freiheit, Urteilskraft oder Mündigkeit zu nehmen“, so die Ausführungen Prechts.[1]
Der Physiker und Kybernetiker Heinz von Foerster, damals Leiter eines führenden Kybernetik-Instituts, des Biological Computer Lab (BCL) an der University of Illinois, Urbana-Champaign, äußerte sich in seinem Grundsatzreferat „Die Verantwortung des Experten“ auf der Herbsttagung der American Society for Cybernetics am 19.12.1971 wie folgt:
„Der Großteil unserer institutionalisierten Erziehungs-bemühungen hat zum Ziel, unsere Kinder zu trivialisieren. … Da unser Erziehungssystem daraufhin angelegt ist, berechenbare Staatsbürger zu erzeugen, besteht sein Zweck darin, alle jene ärgerlichen inneren Zustände auszuschalten, die Unberechenbarkeit und Kreativität ermöglichen. Dies zeigt sich am deutlichsten in unserer Methode des Prüfens, die nur Fragen zulässt, auf die die Antworten bereits bekannt (oder definiert) sind, und die folglich vom Schüler auswendig gelernt werden müssen. Ich möchte diese Fragen als „illegitime Fragen“ bezeichnen.“[2]
Schon beim bloßen Überfliegen der beiden Aussagen fällt auf, dass hier etwas ganz und gar nicht passen will. Der Philosoph deutet Kybernetik als Anpassung und projiziert sie sogleich als Menschenbild auf das Silicon Valley, der Kybernetiker hingegen spricht sich für Unberechenbarkeit und Kreativität aus, mehr noch, später entwickelt er im Nachgang zum kategorischen Imperativ des Aufklärers Kant einen (kybern-)ethischen Imperativ:
„Handle stets so, dass die Zahl der Wahlmöglichkeiten größer wird.“
Zudem steht von Foersters Imperativ in krassem Gegensatz zu algorithmischen Praktiken des Silicon Valley, die uns Nutzer vor Entscheidungen und damit Wahlmöglichkeiten „schützen“ wollen. Die Tatsache, dass Facebook einerseits zu verhindern sucht, dass wir Nippel zu sehen bekommen und uns andererseits über Manipulationen der Timelines und Newsfeeds Kommunikations- und Informations-optionen vorenthält und uns „Klick-Entscheidungen“ abnehmen will, ist hier für nur ein, dafür ein besonders griffiges Beispiel. Die jüngsten Enthüllungen um Cambridge Analytica gehören in denselben Kontext.
Die Kybernetik, Ideologie des Valley und Kampfbegriff in der Debatte um Digitalisierung und Bildung
Precht allerdings steht mit seiner Interpretation der Kybernetik als Silicon Valley-Ideologie nicht allein.
In den letzten Jahren wurde der Term „Kybernetik“, der einen längst totgeglaubten transdisziplinären Wissenschaftsansatz in den 40er bis 70er-Jahren bezeichnet, als ideologischer Kampfbegriff aufgeladen und hielt sogar Einzug in die politischen Debatten. Das zwar nicht an vorderster Front, jedoch immerhin in Anhörungen in deutschen Landesparlamenten, insbesondere im Kontext Digitalisierung und Schule sowie in mehreren einschlägigen Buchpublikationen.
Der Bildungswissenschaftler Matthias Burchardt (Universität zu Köln) und der Mediengestalter und -theoretiker Ralf Lankau (Hochschule Offenburg) sind gefragte Experten in solchen Anhörungen. Gleichzeitig sind sie Gründungsmitglieder des Bündnisses für humane Bildung, das in den Kontexten frühkindliche Bildung, Schule und Hochschule den Digitalisierungsbemühungen gegenüber aus einer Haltung der Sorge heraus sehr kritische und teilweise durchaus bedenkenswerte Positionen vertritt, sofern man von den Interpretationen zur Kybernetik einmal absieht.[3] Die negativen Konnotationen des Begriffs werden meist im Begründungsteil der eigenen Positionen genutzt.
So äußerte sich Burchardt in einer Anhörung des Landtages von NRW am 04.05.2016:
„Das Schlagwort Digitalisierung fasst eigentlich viel von dem zusammen, was im Grunde ein ganz alter Hut ist. Spätestens seit den 1940er Jahren und den Macy-Konferenzen in den USA versucht man die Kriegstechnologie der Kybernetik nutzbar zumachen zur Steuerung von offenen Gesellschaften.“[4]
Zur Kriegstechnologie wird hier, was andernorts als Zweig der Wissenschaften, als ein Ansatz zu einer neuen wissenschaftlichen Disziplin firmierte. Der Vollständigkeit halber muss angemerkt werden, dass die die zehn Konferenzen 1946 – 1953 finanzierende Josiah Macy-Foundation sich zur Förderung der Ausbildung in medizinischen Berufen einsetzt.
In der schriftlichen Stellungnahme Burchardts zur selben Anhörung liest sich seine Kritik wie folgt:
„Das kybernetische Instrumentarium der Informations-erhebung, Kontrolle und Steuerung von sozialen Systemen beflügelt schon seit Beginn die Allmachtsphantasien postdemokratischer Regierungskonzepte (Vgl. z.B. Wiener 1952 oder Tiqqun 2007). Das technokratische Regime der Steuerung unterwirft die soziale Eigenlogik der gesellschaftlichen Felder prozedural unter die Rationalität des informationellen Regelkreises und transformiert dadurch elementar-humane Lebensformen zu technomorphen Funktionsgebilden.“[5]
Burchardt bezieht sich hier neben dem Mitbegründer der Kybernetik und erwiesenen Pazifisten Norbert Wiener auf die 2007 veröffentlichte Schrift „Kybernetik und Revolte“ [6] des anonymen französischen Autorenkollektivs Tiqqun, das eher als eine Art Manifest, als ideologisch aufgeladene polemische Kampfschrift gelesen werden kann denn als historisch-wissenschaftliche Aufarbeitung. Dies lässt sich auch unschwer daran ablesen, dass das Tiqqun-Pamphlet mit Ausnahme eines Zitats von Norbert Wiener nicht eine einzige kybernetische Primärquelle zitiert. Wie auch, denn diese Quellen sind alles andere als geeignet, die Tiqqun-Interpretation zu stützen.
Albert Müller, Historiker an der Universität Wien, profunder Kenner der Kybernetik und ihrer Geschichte sowie Betreuer von gleich drei wissenschaftlichen Nachlässen namhafter Kybernetiker, Heinz von Foerster, Gordon Pask und Ranulph Glanville, bezeichnet dieses Schriftstück als eine „paranoid anmutende Polemik. Immerhin“ werde, so Müller, „hier – sinngemäß – geäußert, Kybernetik hätte sich des modernen Kapitalismus bemächtigt und würde nun die Welt regieren.“[7]
Zitiert also ein Autor diese Quelle, um seine Position zur Kybernetik zu begründen, so setzt er sich möglicherweise leichtfertig dem Vorwurf aus, das für ihn eher eine geschmackliche Präferenz denn wissenschaftlich-historische Akkuratesse im Vordergrund steht.
In einschlägigen Publikationen US-amerikanischer Kritiker des Silicon Valley, der kalifornischen Ideologie, hingegen gelingt es sehr erfolgreich, nicht fündig zu werden. Etwa in Franklin Foer‘s „World without Mind“, das u.a. die Ideengeschichte des Valley sehr kritisch reflektiert oder in Michael Patrick Lynch‘s „The Internet of Us – Knowing More & Understanding Less in the Age of Big Data“ findet sich nicht ein einziges Mal der Term „cybernetics“ genannt, dafür aber das Präfix „cyber-“ in allen möglichen Kompositabildungen.[8,9] Das wirft Fragen auf. Das „Menschenbild der Kybernetik“, eine oder gar die Ideologie des Valley?
Wohlgemerkt, es gibt in den USA eine kleine wissenschaftliche Gesellschaft namens „American Society for Cybernetics“, ASC. Einmal umgekehrt gefragt, wenn Cybernetics doch so einflussreich sein, den Kapitalismus und die neoliberale Ideologie des Valley prägen soll, warum sind US-Autoren dann so blind, dies nicht zu bemerken und zu benennen? Oder sind nur wir Europäer zu dieser tieferen Einsicht prädestiniert?
Folgen wir Ralf Lankau, dann „degradieren Kybernetiker den Menschen zu einer Fehlkonstruktion, der sich den Rechnern unterzuordnen habe, […] und für die Singularisten, Transhumanisten und Kybernetiker sind Maschinen ohnehin die „besseren Menschen“, die den fehlerhaften „homo sapiens“ besser früher als später ersetzen.“[10]
Wer hierzu Günther Anders‘ Satz „Der Mensch wird nebengeschichtlich“ assoziiert, liegt nicht ganz falsch. Ein erstes Indiz für eine genuin europäische Spur der Interpretation.
In einer Stellungnahme für den hessischen Landtag zum Thema Digitalisierung und schulische Bildung schreibt Lankau, dass „Digitalisierung und Neue Lernkultur“ … „zwei Techniken der neoliberalen und marktradikalen Vereinzelung und Isolierung von Menschen“ seien, „um sie einfacher gemäß der jeweiligen Interessen der Anbieter von (Lern-)Software) manipulieren und steuern zu können.“ Dahinter steckten „die reaktivierten Theorien der Kybernetik und des Behaviorismus, realisiert mit Hilfe von Digitaltechnik und Netzwerken“, so Lankau sinngemäß.[11]
Noch drastischer drückt er es in einer Buchpublikation aus:
„Bis heute setzt das kybernetische Denken Kommunikation als Signalübertragung (bzw. Nachrichten-übermittlung) gleich mit Mensch und Gesellschaft als steuerbaren Maschinen. Es findet sich in Kommunikationsmodellen der Nachrichtentechniker Shannon und Weaver ebenso wie bei den Behavioristen mit ihren Input-Output-Systemen (I-O-S) oder dem »programmierten Lernen«, das unterstellt, man könne das Lernen von Menschen programmieren und steuern wie Maschinen.“[12]
Die Kybernetik soll also ein deterministisches Menschenbild vertreten, mit dem Behaviorismus unter einer Decke stecken und das Ziel haben, ganze Gesellschaften zu steuern und zu manipulieren.
Kybernetik und Behaviorismus – eine kurze Spurensuche
Eine Spurensuche zu den Begrifflichkeiten Behaviorismus und Kybernetik führt zurück zu einer Arbeit, deren Veröffentlichung 1943 weit vor den für die Kybernetik begriffsbildenden zehn Macy-Konferenzen (1946 – 1953) liegt. Sie stammt von dem Autorentrio Rosenblueth, Wiener und Bigelow, trägt den Titel „Behavior, Purpose and Teleology“ und führt erstmals die Begrifflichkeiten des Feedback und der Zielorientierung (Teleology) von Systemen ein.[13]
Der US-Wissenschaftshistoriker Peter Galison besteht in seinem einflussreichen Aufsatz „The Ontology of the Enemy: Norbert Wiener and the Cybernetic Vision“ [14] darauf, die Autoren von Behavior … „als Adepten des Behaviorismus zu etikettieren“.[7] Deutliche Äußerungen zum Behaviorismus von Wiener selbst bestätigen dies jedoch nicht:
„Behaviorism as we all know is an established method of biological and psychological study but I have nowhere seen an adequate attempt to analyze the intrinsic possibilities of types of behavior.“[15]
Und wie Albert Müller bemerkt, kann und muss der Aufsatz „Behavior …“ vielmehr als Abgrenzung und „implizite Fundamentalkritik“ am Behaviorismus gelesen werden. Er repräsentiert gewissermaßen eine Art Zeugungsakt für die neue Disziplin der Kybernetik, da hier erstmals wichtige Begrifflichkeiten eingeführt werden.
Galisons Interpretation vermag in diesem Punkt nicht zu überzeugen, denn die kybernetische Fundamentalkritik am Behaviorismus ist allzu leicht nachvollziehbar. Denn für seine simplen Modelle des Verhaltens als lineare Ketten aus Reiz, Reizverarbeitung und Reaktion stellen das Planen und die zielgerichtete Handlung ein massives Problem dar. Die behavioristische Beschreibung mag für die kausale Ereigniskette aus dem Tennisspiel, ankommender Ball – Reaktion – Aktion/Return, gerade noch hinreichend sein, der gute Tennisspieler jedoch antizipiert die Aktionen des Gegners und plant gewissermaßen seine eigenen Schläge. Und sie versagt völlig bei dem Versuch, das improvisierende Klavierspiel – im Moment der Improvisation – z.B. eines Brad Mehldau oder eines Keith Jarrett auch nur im Ansatz zu beschreiben.
Zwei Ordnungen der Kybernetik
Gewissermaßen als Beginn der Kybernetik als wissenschaftliche Disziplin – der Begriff selbst ist antiken Ursprungs – werden in den Kultur- und Medienwissenschaften die schon erwähnten zehn Macy-Konferenzen begriffen, bei denen der Physiologe Warren McCulloch den Vorsitz führte.[16] Gleichwohl müssen hier neben der schon genannten Arbeit „Behavior …“ noch mindestens zwei weitere Publikationen genannt werden, deren Veröffentlichungszeitpunkte deutlich vor den Konferenzen liegen. Hierzu gehört der ebenfalls 1943 erschienene Aufsatz „A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity“ von Warren McCulloch und Walter Pitts, der ein erstes formales Konzept zur Beschreibung neuronaler Netzwerke liefert und somit auch den Beginn der Neuroinformatik markiert.[17]
Und bereits 1945 bricht eben jener Warren McCulloch mit dem Alleinanspruch der Hierarchie als (lineares) Ordnungsschema. In „A Heterarchy of Values determined by the Topology of Nervous Nets“ stellt er der Hierarchie – am Beispiel der platonischen Begriffs-pyramide, quasi der Mutter aller Hierarchien – die Heterarchie (Nebenordnung, Ko-Ordination) als gleichberechtigtes Komplementär-prinzip an die Seite.[18] Hiermit kritisiert er – unter Bezugnahme auf neuronale Strukturen (Topologien) im Rückenmark von Wirbeltieren – explizit den wissenschaftlichen Alleinvertretungsanspruch der klassischen Aristotelisch-Boole‘schen zweiwertigen Logik als unzureichend. Diese Arbeit kann auch als Vorspiel zu dem begriffen werden, was Heinz von Foerster und Kollegen später als die Kybernetik zweiter Ordnung (2nd-order cybernetics) bezeichneten. Sie markiert des weiteren einen Grenzstein dessen, was heute mit den aktuellen Verfahren und Modellen der Neuroinformatik (ANNs, deep learning, etc.) überhaupt möglich ist. Bemerkenswerterweise wird dieser Grenzstein in Grundlagenwerken der Neuroinformatik entweder „vergessen“, oder die Autoren haben überhaupt keine Kenntnis von ihm.
Die Unterschiede zwischen den Kybernetiken erster und zweiter Ordnung hat Francisco Varela am knappsten und griffigsten dargestellt. Die Kybernetik erster Ordnung beschäftigt sich mit beobachtbaren Systemen, die Kybernetik zweiter Ordnung mit beobachtenden Systemen.[19]
Damit wird deutlich, dass im 2nd-order-Bereich das – menschliche – Subjekt ins Spiel gelangt. Eine bislang den Geisteswissenschaften vorbehaltene Domäne. „Kybernetik untersucht alle Phänomene in Unabhängigkeit ihres Materials, so sie regelgeleitet und reproduzierbar sind“, bemerkt hierzu W. Ross Ashby.[20] Hierin implizit enthalten ist der Kern einer neuen wissenschaftlichen Denkkultur, die den klassischen Methodendualismus zwischen den – idiographischen – Geistes- oder Humanwissenschaften und den subjektlosen – nomothetischen – Naturwissenschaften in Frage stellt. Bei konservativ ausgerichteten Wissenschaftlern beider Bereiche kann dies jedoch Unbehagen und Misstrauen gegenüber der Kybernetik induzieren. Möglicherweise liegt hierin – in einer Art Konkurrenzempfinden – ein tieferer Grund dafür, dass einige Geisteswissenschaftler negativen Konnotationen des Begriffs der Kybernetik zuneigen. Dies gilt insbesondere für das Werk des „Philosophen der Kybernetik“, Gotthard Günther, der sich ausgewiesenermaßen als Grenzgänger und Brückenbauer zwischen Formalem und Sprachlichem, zwischen Zahl und Begriff (Number and Logos), betätigte.
Kybernetisches Denken – insbesondere das der 2nd-order Kybernetiker – firmiert somit als eine wissenschaftliche Geste, die sich gegen die bestehenden – wissenschaftlichen und gesellschaftlich-politischen – Verhältnisse richtet! Die eingangs zitierte Bemerkung von Foersters ist nur eine von überaus zahlreichen Belegstellen bei zahlreichen Autoren der Kybernetik.
Die Charakterisierung der Kybernetik im medienwissenschaftlichen Narrativ als Kriegswissenschaft und Methoden- und Modellbaukasten für soziale Kontrolle, Steuerung und Manipulation steht also belegbar in einem überaus merkwürdigen Widerspruch zu vielen kybernetischen Primärquellen und darüber hinaus zur Selbstwahrnehmung und Selbstpräsentation vieler Kybernetiker. Albert Müller merkt dazu an:
„Nicht wenige von ihnen sahen sich selbst als politisch links oder liberal, mitunter gar als anarchistisch.“[7]
Nun kommen aber die Konnotationen und Interpretationen der oben zitierten Personen und so einiger weiterer Autoren nicht von ungefähr. Daher gilt es, die Spur dieser Realitätskonstruktionen zum Begriff der Kybernetik einmal zu untersuchen, zu versuchen, sie nachzuzeichnen.
Die lückenhafte Spur der Kybernetik in Kultur- und Medienwissenschaften
In den letzten beiden Jahrzehnten erfuhr der Begriff der Kybernetik in kultur- und medienwissenschaftlichen Kontexten und jüngst auch in politischen Debatten im eher linken Lager eine publizistische Renaissance.
Folgendes sei hier neben zahlreichen kleineren Artikeln und Blogbeiträgen stellvertretend genannt. 2007/08 erschienen drei Buchpublikationen, die Kybernetik entweder im Titel oder im Untertitel tragen, das schon erwähnte „Kybernetik und Revolte“ des frz. Autorenkollektivs, Andrew Pickering, „Kybernetik und neue Ontologien“ (Berlin 2007) sowie der Sammelband „Die Transformation des Humanen. Beiträge zur Kulturgeschichte der Kybernetik (Hg. Michael Hagner u. Erich Hörl, Frankfurt a.M. 2008).
In einer „zweiten Welle“ folgten 2012 Rainer C. Becker, „Black Box Computer – Zur Wissensgeschichte einer universellen kybernetischen Maschine“ (Bielefeld 2012, eine Dissertation aus 2008), 2016 das recht populär gewordene und vielfach rezensierte Werk von Thomas Rid, „Maschinendämmerung – Eine kurze Geschichte der Kybernetik“ (Berlin 2016) und 2017 „Kybernetik, Kapitalismus, Revolutionen – Emanzipatorische Perspektiven im technologischen Wandel“ (Hg. Paul Buckermann, Anne Koppenburger, Simon Schaupp, Münster 2017), wiederum ein Sammelband.
Und über Anna-Verena Nosthoff und Felix Maschewski fand unlängst das Thema „Kybernetisierung des Politischen“ [21] auch Eingang in die Debatten z.B. bei der Rosa Luxemburg-Stiftung.
Nahezu alle genannten Veröffentlichungen greifen zitierend und interpretierend zurück auf das 2003 und 2004 von Claus Pias herausgegebene 2-bändige Werk „Cybernetics / Kybernetik. The Macy-Conferences 1946–1953“.[22] Der erste Band enthält sämtliche Protokolle der letzten fünf der insgesamt zehn Konferenzen. Die Wortprotokolle entstanden auf die Initiative von Heinz von Foerster, der ab der sechsten Konferenz mit der ursprünglichen Herausgeber-schaft beauftragt war. Er entschloss sich, die mitstenographierten Diskussionen nahezu vollständig transkribieren zu lassen, um den dialogisch-explorierenden Charakter der Gespräche zu erhalten. Letztlich gebührt Claus Pias der wesentliche Dank dafür, diese Bände – der zweite Band von Cybernetics beinhaltet interpretierende Essays und weitere Dokumente zur Kybernetik – für eine breitere Diskussionsgrundlage herausgegeben zu haben.
Sehr merkwürdig mutet die Tatsache an, dass außer bei Becker in „Black Box Computer“ und in den Aufsätzen von Erich Hörl und des Soziologen Dirk Baecker die vielleicht bedeutendste Folge der Macy-Konferenzen überhaupt nicht erwähnt wird, noch nicht einmal im Werk von Thomas Rid.
Gemeint ist die Gründung eines eigenen Forschungsinstituts, des Biological Computer Laboratory (BCL, Univ.. of Illinois, Urbana-Champaign), das von 1958 bis 1976 existierte und von Heinz von Foerster geleitet wurde. Sogar der Herausgeber Claus Pias erwähnt es in seiner Einstimmung zu dem 2-bändigen Werk nicht. Dies bleibt ausschließlich Heinz von Foersters „Erinnerungen …“ im 2. Band überlassen.[23] Und das ist umso verwunderlicher, weil dort erstmals die Idee des Parallelrechnens entstand. Albert Müller kritisiert ebenfalls, dass das BCL in der kultur- und medienwissenschaftlichen Rezeption so gut wie gar nicht erwähnt wird.[24]
Dabei entstanden am BCL ganz wesentliche Arbeiten zu neuronalen Netzwerken, zur Theorie autopoietischer Systeme (Maturana/Varela), zu Selbstorganisation und zur Philosophie der Kybernetik, zur Polykontexturalitätstheorie und Logik (Gotthard Günther, Lars Löfgren) sowie zu Musiktheorie und Computermusik (Herbert Brün, Heinz von Foerster), um nur einige wenige zu nennen. Das Institut ist somit – gemessen an den dort arbeitenden Personen und ihren zahlreichen Veröffentlichungen – in der Ideengeschichte der Kybernetik kein wissenschaftshistorisch vernachlässigbares Detail!
In seinem einflussreichen Aufsatz „The Ontology …“ [14] erwähnt Galison das BCL nicht, obwohl dort die prominentesten Vertreter der Kybernetik entweder arbeiteten oder mit den Kollegen am BCL kooperierten, darunter auch Warren McCulloch, Norbert Wiener und Gregory Bateson. Galison bleibt seltsam fixiert auf Norbert Wiener, John von Neumann und die Bombe sowie seine These von der Kybernetik als Kriegswissenschaft. Bemerkenswert ist, dass gerade diese These durch die Bezugnahme auf das BCL – vordergründig betrachtet – eine zusätzliche Bekräftigung hätte erfahren können, denn das Institut wurde überwiegend durch das US-Militär finanziert, insbesondere durch das AFOSR, das Airforce Office of Scientific Research.

Es hat in mehrererlei Hinsicht und insbesondere für uns Europäer durchaus etwas Groteskes, wenn z.B. der philosophische Aufsatz Gotthard Günthers, „Das metaphysische Problem einer Formalisierung der transzendental-dialektischen Logik“, ebenso wie andere am BCL entstandene Texte Günthers den Vermerk tragen: „Prepared under the Sponsorship of the Airforce Office of Scientific Reseach, Directorate of Information Sciences, Grant AF-AFOSR-xx“.[25]
Dabei hatte diese Förderung durch die Airforce ihre Konsequenzen. Für die Rezeption des Autors in Deutschland. Als Günther 1968 das 1967 erschienene Werk „Zur Logik der Sozialwissenschaften“ von Jürgen Habermas in der Zeitschrift „Soziale Welt“ scharf kritisierte, wurde kolportiert, dass aus Kreisen um Habermas geäußert worden sei, den Günther müsse man nicht lesen, der sei ja von der US-Airforce bezahlt.[26]
Hierzu ist anzumerken, dass es in den USA bis Ende der 60er-Jahre eine gemeinsame Verantwortung aller staatlichen Institutionen für die staatliche Forschungsförderung – insbesondere der Grundlagen-forschung – gab, dazu gehörte eben auch das Militär.
Die Gegenthese zu Galisons Kybernetik als Kriegswissenschaft lässt sich flankieren durch eine historisch-politische Tatsache, die in medien- und kulturwissenschaftlichen Publikationen in Europa ebenso wenig Erwähnung findet wie das BCL selbst, sieht man einmal von Albert Müller ab.
Die Förderbedingungen änderten sich mit den studentischen Protesten gegen den Vietnamkrieg in den USA. Senator Mike Mansfield machte, um die Situation an den Universitäten zu entspannen, den Vorschlag, alle Forschungsförderungen des Militärs zu überprüfen und nur noch solche Projekte zu fördern, die einen direkten militärischen Nutzen hatten.[27] 1969 verabschiedete daher der US-Kongress das sogenannte Mansfield-Amendment, das 1970 in den Defense Procurement Authorization Act integriert wurde.[28]
Entsprechend dem Mansfield-Amendment war nun jeder Wissenschaftler, der Förderungen über das DoD, das Department of Denfense, erhielt, angehalten, die Bezüge seiner Forschungen zu militärischen Aufgaben zu erläutern. Heinz von Foerster erklärte freimütig: „the research at BCL was not related to a military mission“.[29] Damit endete die Förderung für das BCL, da sich woanders Mittel im selben Umfang nicht beschaffen ließen. Das Institut wurde 1974 geschlossen und abgewickelt.
Filterblasen in Kultur- und Medienwissenschaften – der militärische Bias
„Die Sprache sagt: „Geh dort lang, und wenn du das und das siehst, biege in die und die Richtung ein.“ Mit anderen Worten: sie bezieht sich auf den Diskurs des Anderen“ Friedrich Kittler, Jacques Lacan zitierend. [30]
Neben Galison gibt es mindestens eine zweite Spur der Zitationen und Interpretationen zur Kriegswissenschaft, die auf den einflussreichen Kulturwissenschaftler und Medienphilosophen Friedrich Kittler zurückgeht. Von ihm ist hinreichend bekannt, dass er immer wieder interpretierend auf Kriegstechnologie und Krieg als Ursprung Bezug nahm.[31] Nicht wenige kritisierten seine Interpretationen – in diesem speziellen Punkt! – als zu monoperspektivisch fixiert.[26]
Sowohl für das Schillersche Spiel als urmenschliche Aktivität als auch für die Subversion als Ausdruck kreativer Betätigung gibt es dann – als alternative mögliche Ursprünge von Technik und Technologie – dort keine Plätze mehr.
Diese Kittlersche Spur der Interpretation lässt sich sogar noch weiter zurückverfolgen bis zu Martin Heidegger [32], der das Wort „Kybernetik“ öffentlich nur ein einziges Mal in den Mund genommen hat. Auf die Frage von Rudolf Augstein und Georg Wolff zum Ende der Philosophie in seinem Spiegel-Interview: „Und wer nimmt den Platz der Philosophie jetzt ein?“, antwortete er knapp: „Die Kybernetik.“[33]
Heideggers Schatten ist lang – in mancherlei Hinsicht. Jedenfalls hatte er den Kybernetik-Philosophen Gotthard Günther eingehend studiert, dies jedoch nie öffentlich gemacht. Wir sind gezwungen, uns bis zur Öffnung des Heideggerschen Archivs auf eine von Otto Pöggeler schriftlich verifizierte mündliche Bemerkung Heideggers ihm gegenüber zu verlassen, nach der Heidegger gesagt hat, dass er die Lektüre Günthers für sehr lehrreich halte, gerade weil er scheitere.[34]
Die Interpretationen aus Kultur- und Medienwissenschaften sowie die Positionen der sich darauf in politischen Debatten Berufenden einfach als Technoskeptizismus abzutun greift fehl. Es spiegelt sich dort vielmehr ein Verfahren im Diskurs, das sich selbst durch einen Mechanismus der Iteration eingrenzt und sich gegen alternative oder zusätzliche – wie gezeigt durch Quellen belegbare – Interpretations- oder Erkenntniswege verwehrt. Es weist damit die Charakteristika einer zitatorischen Echokammer auf, einer Filterblase, die ein dominierendes Narrativ einer bestimmten Färbung ausprägt. Dieses wird gebildet und verfestigt durch wiederholte Iterationen ähnlicher Interpretationen, die Quellenwahl wird selektiv, d.h. anderslautende Quellen werden selten bis gar nicht als solche registriert. Kybernetik und Macy-Konferenzen verbleiben als ein Hauptanker der Kritik.
Dazu gehört auch, dass andere mögliche Ansatzpunkte der Kritik, wie beispielsweise die zentralen Rollen Marvin Minskys, Claude Shannons und der Dartmouth-Konferenz 1956 nicht oder nur wenig in den Blick genommen werden. Hier wurde immerhin der Begriff „Artificial Intelligence“ ins Leben gerufen, der auf heutige Entwicklungen einen sehr hohen Impact hatte.
Ironischerweise wird das Phänomen Filterblase in den Kultur- und Medienwissenschaften nicht nur mit Blick auf Facebook und andere „soziale“ Netzwerke – in der letzten Zeit eingehend reflektiert. Jedoch scheint die gerade von den Kybernetikern ausdrücklich thematisierte Selbstreferenz, hier als reflektierender zusätzlicher Blick auf den eigenen Fokus, in den Medienwissenschaften zu fehlen.
Das ist umso bedauerlicher, denn viele kybernetische Primärquellen bieten tiefere Einsichten und Positionen, die erheblich bereichernde Argumente zur Kritik der kalifornischen Ideologie liefern können.
Vom Standpunkt der Kybernetik zweiter Ordnung aus betrachtet sind die aktuellen IT-Systeme der Multis als zentralistisch organisierte simple Input-Output-Systeme beschreibbar, die in die eine Richtung als Datenstaubsauger arbeiten und in die andere als Instrument zur auf das Individuum bezogenen Selektion und Bereitstellung von Informationen mit dem Ziel, gesellschaftliche Gruppen zu fraktalisieren. Demokratische Rückkopplungen, wie Vilém Flusser sie erhofft hatte, sind das definitiv nicht.[32]
Insofern – um einmal in einem armoristischen Bild zu bleiben – stellen die aktuellen kritischen Positionierungen und Debattenbeiträge, die in ihren Begründungen die Kybernetik als Kriegs- und Steuerungs-wissenschaft für Gesellschaften interpretieren, eine argumentative Selbstentwaffnung dar.
Man möchte, fast verzweifelt, mit dem Phänomenologen Edmund Husserl ausrufen:
„Zu den Sachen selbst!“
Hier sinngemäß „Lest die kybernetischen Primärquellen!“
Oder, wir bleiben erst mal in der Turing-Galaxis.
Obwohl, Alan Turing hat das nicht verdient.
So long, Nick H. aka Joachim Paul
Quellen
[1] Richard David Precht, Focus, 16.12.2017
[2] Heinz von Foerster, Die Verantwortung des Experten, Überarbeitete Fassung des Grundsatzreferats zur Herbsttagung der American Society for Cybernetics, 09.12.1971; in: Heinz von Foerster, Sicht und Einsicht, Braunschweig, Wiesbaden 1985, S. 17-23, S. 21f
[3] Bündnis für humane Bildung, www.aufwach-s-en.de
[4] Landtag von Nordrhein-Westfalen – S. 14 des Ausschussprotokolls vom 04.05.2016,
[5] Matthias Burchardt, Stellungnahme 16/3737, S. 8,
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMST16-3737.pdf
[6] Tiqqun, Kybernetik und Revolte, 2007,
[7] Albert Müller, Zur Geschichte der Kybernetik – Ein Zwischenstand, Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, ÖZG 19.2008.4, S. 22, Quelle 3,
http://www.studienverlag.at/data.cfm?vpath=openaccess/oezg-42008-mueller
[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Franklin_Foer
[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_P._Lynch
[10] Ralf Lankau, Systemfehler. Oder: Es gibt kein richtiges Leben im digitalen, Papier zu den Buckower Mediengesprächen:
http://lankau.de/wp-content/uploads/sites/7/2014/10/lankau_buckow16_final.pdf
[11] Ralf Lankau, Digitalisierung und schulische Bildung, Hessischer Landtag, 14.10.2016
http://www.aufwach-s-en.de/wp-content/uploads/2017/06/Lankau_Hessischer_Landtag_Stellungn_2016.pdf
[12] [Ralf Lankau, Kein Mensch lernt digital, Weinheim, Basel 2017, S.48
[13] Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener u. Julian Bigelow, Behavior, Purpose and Teleology, in: Philosophy of Science 10 (1943), 18–24.
[14] Peter Galison, The Ontology of the Enemy: Norbert Wiener and the Cybernetic Vision, Critical Inquiry, Vol. 21, No. 1. (Autumn, 1994), pp. 228-266, Univ. of Chicago Press –
http://jerome-segal.de/Galison94.pdf
[15] Norbert Wiener, Letter to J. B. S. Haldane, 22 June 1942, Box 2, Folder 62, NiVP – zitiert nach Galison
[16] https://de.wikipedia.org/wiki/Macy-Konferenzen
[17] Warren S. McCulloch and Walter Pitts, „A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity“, Bulletin of Mathematical Biophysics (1943), 5, 115-133
[18] Warren S. McCulloch, A Heterarchy of Values determined by the Topology of Nervous Nets, Bulletin of Mathematical Biophysics, 7(1945) 89-93
[19] Stuart Umpleby, Definitions of Cybernetics, 1982, rev, 2000,
http://asc-cybernetics.org/definitions Anm. vom 14.05.2018: Wie mir Albert Müller via Email mitteilte, hat sich Stuart Umpleby auf seiner hier zitierten Definitionsseite wohl geirrt. „Die Definitionen finden sich erstmals auf Seite 1 des Bandes Cybernetics of Cybernetics (1974) und sind beide eindeutig mit [H.V.F.] unterschrieben. Stuarts kleine Verwechslung ist insofern kurios, als sowohl er selbst als auch Varela zu dem Band beigetragen haben. Varelas Beiträge snd mit [F.V.] gekennzeichnet.“ Die im Text angegebenen Def. stammen also von Heinz von Foerster.
[20] W. Ross Ashby, Einführung in die Kybernetik, Frankfurt a.M. 1985, S.7
[21] Anna Verena-Nosthoff, Felix Maschewski, https://agora42.de/interview-mit-anna-verena-nosthoff-und-felix-maschewski/
[22] Claus Pias, Hg., Cybernetics / Kybernetik. The Macy-Conferences 1946–1953, Bd. I Transactions/ Protokolle, Zürich, Berlin 2003, und, Claus Pias, Hg., Cybernetics / Kybernetik. The Macy-Conferences 1946–1953, Bd. II Essays and Documents / Essays und Dokumente, Zürich, Berlin 2004.
[23] Heinz von Foerster, Erinnerungen an die Macy-Konferenzen und die Gründung des Biological Computer Laboratory, in: Claus Pias, Hg., Cybernetics / Kybernetik. The Macy-Conferences 1946–1953, Bd. II Essays and Documents, Berlin 2004
[24] Albert Müller, Eine kurze Geschichte des BCL, Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 11 (1), 9-30, Wien 2000,
https://www.univie.ac.at/constructivism/papers/mueller/mueller00-bcl.pdf
[25] Gotthard Günther, Das metaphysische Problem einer Formalisierung der transzendental-dialektischen Logik, in: Heidelberger Hegeltage 1962, Hegel-Studien Beiheft 1, S. 65-123, abgedruckt in: Gotthard Günther, Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik, Bd 1, Hamburg 1976, S. 189-247
[26] Rudolf Kaehr, Gisela Behrendt, private Kommunikationen
[27] https://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Mansfield
[28] Ronda Hauben, Creating the Needed Interface. – Telepolis: Magazin der Netzkultur 1999, https://www.heise.de/tp/features/Creating-the-Needed-Interface-3563729.html
[29] Stuart Umpleby, Heinz von Foerster and the Mansfield Amendment, Cybernetics an Human Knowing, Vol 10, nos. 3-4, pp. 187-190
https://www.researchgate.net/publication/233661621_Heinz_von_Foerster_and_the_Mansfield_Amendment
[30] Friedrich Kittler, Die künstliche Intelligenz des Weltkriegs: Alan Turing, in: Die Wahrheit der technischen Welt, Berlin 2013, S. 232-252, S. 234
[31] Friedrich Kittler, Unberechenbarkeit, https://www.youtube.com/watch?v=AavTap5FgSQ
[32] Christopher Busch, Strategische Zitate. Zu Friedrich Kittlers Heidegger-Lektüre, Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Sep. 2014, Vol. 44, Issue 3, pp 161–169,
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03379990
[33] Martin Heidegger, „Nur noch ein Gott kann uns retten“. In: Der Spiegel, 30. Jg., Nr. 23, 31. Mai 1976. Das Gespräch mit Rudolf Augstein und Georg Wolff fand am 23. September 1966 statt. Das vollständige Gespräch ist abgedruckt in: Günther Neske & Emil Kettering (eds.), Antwort – Martin Heidegger im Gespräch, Pfullingen 1988
[34] Cai Werntgen, Kehren: Martin Heidegger und Gotthard Günther: europäisches Denken zwischen Orient und Okzident, München 2006, S. 12
[35] Vilém Flusser, Verbündelung oder Vernetzung? in: Kursbuch Neue Medien, Mannheim 1995, S. 15-23

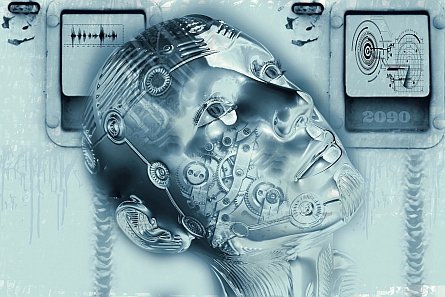
 ~20min Lesezeit
~20min Lesezeit
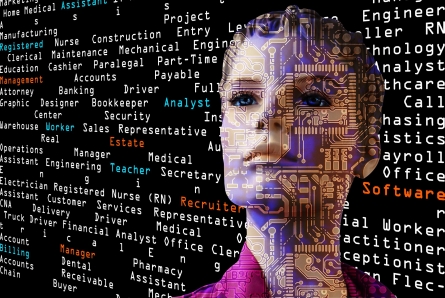 Hat mal jemand aus dem Bündnis die Vergangenheit unseres Schulsystems, seine Geschichte kritisch in den Blick genommen? Offensichtlich nicht, denn dann wäre aufgefallen, dass trotz dieser zweckgebundenen Ausrichtung des Schulsystems genügend Lehrkräfte den Menschen, den Schüler, die Schülerin im Blick hatten und einen gut Teil Bildung, humanistische Bildung, Bildung als Selbstzweck und nicht als bloße ökonomische Notwendigkeit vermittelt haben. Zumindest an meinem Gymnasium war das so. Mit allen Imponderabilien, die so eine Schulzeit mit sich bringt ;-), denn ideal ist nix. Und Verwerfungen gab es auch. Ohne Zweifel.
Hat mal jemand aus dem Bündnis die Vergangenheit unseres Schulsystems, seine Geschichte kritisch in den Blick genommen? Offensichtlich nicht, denn dann wäre aufgefallen, dass trotz dieser zweckgebundenen Ausrichtung des Schulsystems genügend Lehrkräfte den Menschen, den Schüler, die Schülerin im Blick hatten und einen gut Teil Bildung, humanistische Bildung, Bildung als Selbstzweck und nicht als bloße ökonomische Notwendigkeit vermittelt haben. Zumindest an meinem Gymnasium war das so. Mit allen Imponderabilien, die so eine Schulzeit mit sich bringt ;-), denn ideal ist nix. Und Verwerfungen gab es auch. Ohne Zweifel.
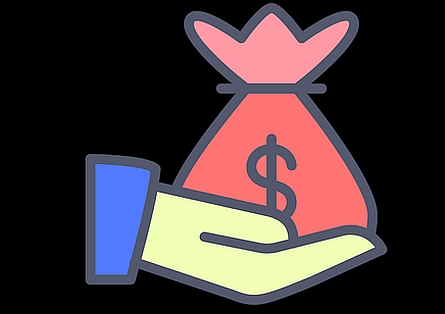

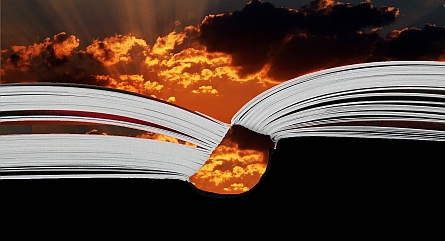 Verfolgen wir einfach mal eine fast typische Diskussion zwischen einem Digitalisierungsbefürworter, einem Technologiefreund – sagen wir aus dem Silicon Valley, genannt B, und einem Digitalisierungskritiker, hier K für Kritik, die in Deutschland auch schon mal Kulturpessimisten genannt werden:
Verfolgen wir einfach mal eine fast typische Diskussion zwischen einem Digitalisierungsbefürworter, einem Technologiefreund – sagen wir aus dem Silicon Valley, genannt B, und einem Digitalisierungskritiker, hier K für Kritik, die in Deutschland auch schon mal Kulturpessimisten genannt werden: